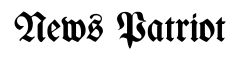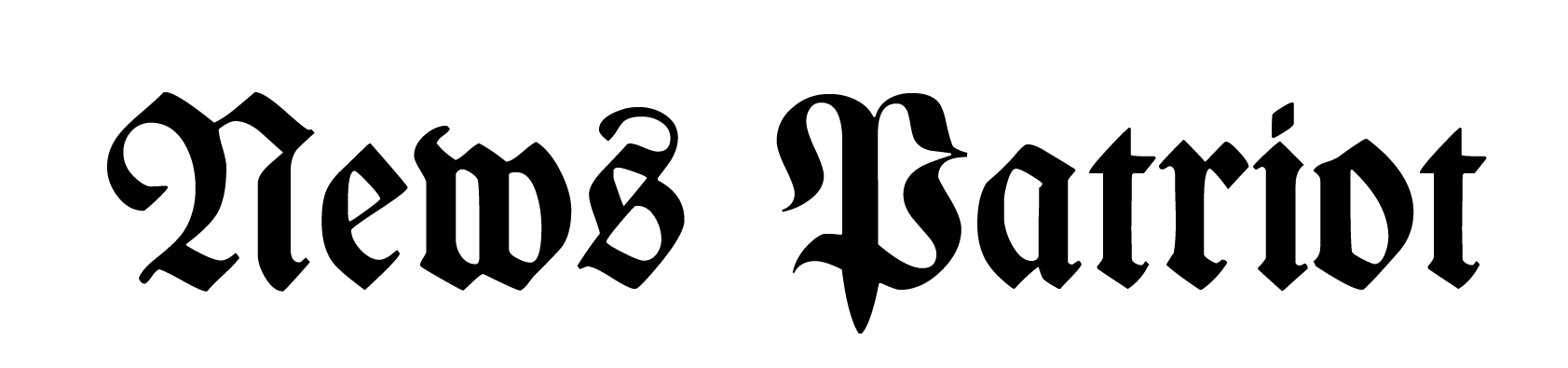Amerika braucht nicht die geballte Faust, sondern die ausgestreckte Hand
Selten zuvor haben die Vereinigten Staaten von Amerika so dringend einen Versöhner-in-Chief benötigt wie heute. Eine zentrale Figur, die das politische Gewicht und die Glaubwürdigkeit besitzt, um eine nicht mehr nur zerstrittene, sondern untereinander verfeindete Nation dazu zu bringen, sich die Hand zu geben und einen ehrlichen Neustart zu wagen. Einen Neustart bei der Bewältigung der natürlichsten Sache der Welt in einer gesunden Demokratie: Wie regelt man zivilisiert und auf faire Weise Meinungsverschiedenheiten über die Zukunft des Landes?
Nach dem Attentat auf Donald Trump, das nur durch eine glückliche Fügung nicht mit seinem Tod endete, stehen die USA an einer Weggabelung, deren Bedeutung nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Die Supermacht kann weiterstolpern auf dem von Republikanern wie Demokraten ausgetretenen Pfad der gegenseitigen Verteufelung. Dann ist es nur eine Frage der Zeit, wann der Druck im Kessel so groß wird, bis es zu einer echten Explosion kommen könnte; sprich zu bürgerkriegsähnlichen Szenen.
Oder die führenden Köpfe in beiden Lagern finden gemeinsam zurück zu einer Sprache, in der auf Dämonisierung und Entmenschlichung grundsätzlich verzichtet wird. Und in der mental ein für alle Mal klar gezogen wird, dass „ballots“ (Wahlzettel) und nicht „bullets“ (Gewehrkugeln) das einzige Mittel im politischen Wettstreit sein dürfen.
Joe Biden hat mit abgewogenen Wortmeldungen und (leider wieder teilweise verstolperten) Ansprachen nach den Schüssen auf seinen Kontrahenten den Anfang gemacht. Seine unmissverständliche Ächtung von Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung und seine Forderung, Amerika müsse schnellstens „die Temperatur“ senken, waren richtig und angemessen.
Aber es wäre aufrichtiger gewesen, hätte Biden den Eigenanteil an der entstandenen „Hitze“ eingeräumt. Wer seinen Gegner permanent als die „größte Gefahr für die amerikanische Demokratie“ bezeichnet, ist nicht unschuldig am beunruhigenden Zustand der Nation. Das gilt umso mehr für Donald Trump.
Amerika hat durch ihn in den vergangenen Jahren, auch begünstigt durch die Dreckschleuderei in sozialen Medien, verlernt, beim Austragen von Meinungsverschiedenheiten den jeweils anderen nicht sofort als Feind zu sehen. Sondern als Landsmann, Nachbarn und Mitbürger, der anders tickt. Als Amerikaner eben.
Dazu haben die, die den Ton vorgeben in Washington in beiden Parteien, nennenswert beigetragen. Wenn jeder Zwist zur Existenzfrage aufgeblasen wird, wenn man es unter „Apokalypse“ und „Armageddon“ einfach nicht mehr macht, um die möglichen Folgen politischer Entscheidungen zu charakterisieren, ist es kein Wunder, wenn Sachargumente untergehen.
Ob es in dieser Gemengelage vorsichtig hoffnungsfroh stimmen darf, wenn Trump nach seiner Nahtod-Erfahrung mitteilt, er habe seine für den Parteitag in Milwaukee vorbereitete „extrem harte Rede“ gegen die Demokraten „weggeworfen“ und wolle nun für die „Einheit der Nation“ eintreten, muss sich erst noch zeigen.
Trump ist bekannt für Kalkül und Lippenbekenntnisse. Und sein Sündenregister ist entschieden dicker als das von Joe Biden, der nie auf die Idee kommen würde, einen politischen Gegner als „Ungeziefer“ zu bezeichnen. In Milwaukee wird sich zeigen, ob aus der ikonischen Faust, die Trump nach den Schüssen mit blutverschmiertem Gesicht geballt hat, die ausgestreckte Hand wird, die Amerika so bitter nötig hat.
Pressekontakt:
BERLINER MORGENPOST
Telefon: 030/887277 – 878
bmcvd@morgenpost.de